Religion und Kultur im Strudel der globalisierten Moderne
Die letzten Präsidentschaftswahlen in den USA, der Erfolg rechtsextremer Parteien und Bewegungen und die islamistischen Terroranschläge der letzten Jahre veranschaulichen die Präsenz dieser Logik im „Westen“. Nativistische und religiös-fundamentalistische Bewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind Beispiele für identitäre Bewegungen in anderen Kontinenten und Kulturen. Die Allianzen zwischen religiösen und politischen Akteuren sind in den genannten Beispielen oft unübersehbar. Sie reichen von Formen der subtilen Unterstützung bis hin zur offenen Kooperation.

Die genannten Dynamiken stellen die Theologie und Kirche vor drängende Herausforderungen. Auf einer grundlegenden Ebene gilt es zu fragen: Was ist überhaupt Identität? Wie konstituiert sie sich und warum rückt sie heute in dieser prominenten Weise in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit? Welche gesellschaftlichen Herausforderungen verbergen sich hinter den zeitgenössischen Auseinandersetzungen um Identität? Welche sind die Bedingungen, unter denen in einer globalisierten Moderne (soziale, politische, religiöse) Identitäten gebildet und verhandelt werden? Wie sind Identitätsbildungsprozesse in koloniale, post- und neokoloniale Zusammenhänge eingeflochten? Wie hängen dabei globale Dynamiken und die Herausforderungen eines jeweils spezifischen Kontextes zusammen? Wie verbinden sich die Fragen nach Identität und Macht?
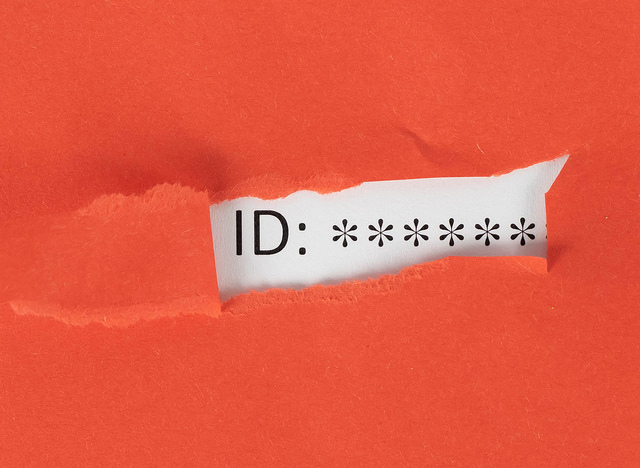
Aus einer expliziter theologischen Perspektive sind insbesondere die folgenden Fragen von Relevanz: Auf welche theologischen Motive wird im globalen Ringen um Identitäten Bezug genommen? Was heißt und wie bildet sich eine „christliche Identität“? Wo liegen Ansatzpunkte für eine identitäre Interpretation des Christentums innerhalb der christlichen Tradition und wie lässt sich diesen begegnen? Was folgt aus den eben genannten Punkten für die Praxis der Christinnen und Christen sowie der Kirchen und Religionsgemeinschaften? Wo sind die Orte, an denen man sich den genannten Fragen zu stellen hat? Wie lässt sich christliche Gemeinschaft auf eine Weise leben, die in authentischer Weise Zeugnis von der sie tragenden Hoffnung gibt, ohne dabei in eine identitäre Abgrenzungs- und Profilierungslogik zu verfallen? Was bedeuten die Tendenzen zu identitären Gemeinschaftsformen in Politik und Religion für den interreligiösen und interkulturellen Dialog? Wie lässt sich theologisch und kirchlich den hinter diesen Tendenzen verborgenen Ängsten begegnen?
Von 25. bis zum 28. Oktober findet am Center for Liberation Theologies der KU Leuven ein internationaler und interdisziplinärer Workshop statt, der sich eben diesen Fragen widmen wird. Unter dem Titel „Die identitäre Versuchung. Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft“ werden rund 40 Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen unterschiedlicher Kontexte und Disziplinen ihre Thesen zum Thema vorstellen.
Interessierte an der Thematik sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Vorträge werden in deutscher und englischer Sprache gehalten. Die Tagungsgebühr beträgt 40€. Das Programm und nähere Informationen sind hier zu finden.
Anmeldungen sind möglich über anthony.atansi@kuleuven.be
-
t
Sebastian Pittl
-
Y
Ulrich Brand/Markus Wissen, Die imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017.
-
Y
Andreas Reckwitz, Zwischen Hyperkultur und Kulturessenzialismus. Die Spätmoderne im Widerstreit zweier Kulturalisierungsregime, 16.01.2017.
-
Y
Olivier Roy, Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren entwurzelter Religionen, Bonn 2011.